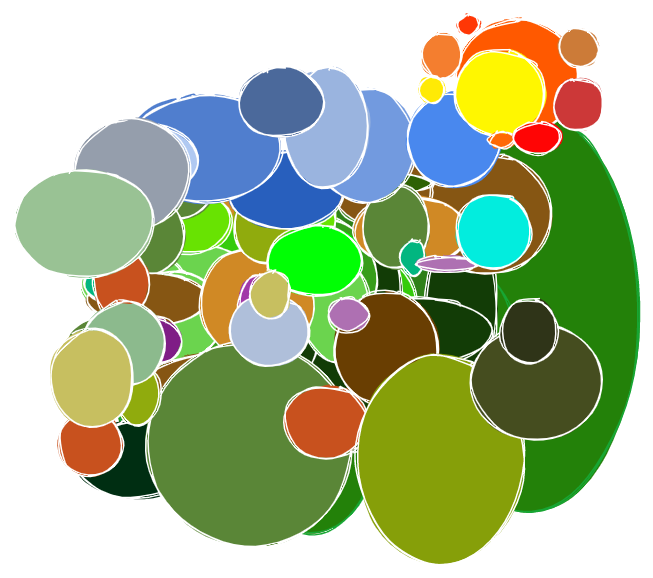Im Juli besuche ich den Schafhof bei St. Peter, einem Dörfchen auf einer Erhöhung unweit von Freiburg. Seit etwa fünf Jahren hat eine Kommune den Schafhof übernommen. Auf 60 ha Weidefläche werden Rinder für Bioland-zertifiziertes Fleisch gezüchtet. Außerdem betreiben die Kommunaden eine Pferdepension mit einem Dutzend Pferden, halten Schafe und Hühner und produzieren Obst und Edelbrände. Ihre Produkte vermarkten sie direkt auf dem Hof und in einem kleinen Selbstbedienungsladen an der Straße.
Auf dem Hof steht ein Haus, das Gemeinschaftsräume, eine große Küche, ein Büro und ein paar Kommunaden beheimatet. Die restlichen Kommunenmitglieder leben auf einer Wiese gegenüber in Bauwägen und kleinen Hütten, oder im Dorf. Außerdem gehört dem Hof eine Waldfläche von 30ha.
Eine steile Straße windet sich 700 Meter vom Glottertal hoch zum Schafhof. Ich sitze auf einer groben Bank aus einem massiven Baumstamm und beobachte ein kurioses Schauspiel. Nacheinander, mal schnaufend, mal elgant, mal keuchend und mal sportlich trotzt ein Mensch nach dem anderen der Schwerkraft und radelt auf der steilen Straße am Schafhof vorbei. Je nach sportlicher Verfassung der strampelnden Beine und Motorisierung der gequälten Zweiräder ergibt sich eine erstaunliche Varietät verschiedenster Körperhaltungen, Gesichtsausdrücke, Atemtechniken, Flüche, Geschwindigkeiten und Schweißmuster auf den Rücken der Radfahrerinnen und Radfahrer. Dieses Spektakel wurde zu einer meiner liebsten Freizeitbeschäftigungen während meines Besuchs, neben der Lektüre und dem Baden im Weiher.
Aber zurück zum Schafhof. Gegenüber der Eingangstür des Hauses befindet sich ein Garten, der mit einjährigem Gemüse wie Bohnen, Salat, Tomaten und Zucchini bepflanzt ist und der von üppigen Beerensträuchern eingerahmt wird. Der Garten ist nur für die Selbstversorgung gedacht und wird mit viel Handarbeit gepflegt. Wie ich schon in Naulitz beobachten konnte, wird der Boden mit einer Grelinette gelockert. Was der Garten nicht hergibt, muss erworben werden. Die Kommune bezieht ihre Einkünfte vor allem aus der Produktion von Fleisch, der Pferdepension und der Vermietung einer Ferienwohnung in Alleinlage (genannt "das rote Häusle").
Das Wasser zum Trinken liefert eine Quelle, deren Überlauf einen kühlen Weiher speist. Beim Baden in diesem Weiher stoße ich auf eine erstaunliche Tierwelt. Teichmolche, die mit ihren kleinen Zacken und ihren bunten Farben wie kleine Dinosaurier aussehen, tauchen aus den Tiefen auf, um die Wasserläufer an der Oberfläche zu fangen. Zwei Enten drehen kunstvoll ihre Runden, als wäre der Weiher ihre Manege, und mehrmals sehe ich eine Ringelnatter vom Ufer ins Wasser gleiten und sich im Schilf auf der Sonnenseite des Gewässers verstecken.
An meinem ersten Tag auf dem Schafhof lerne ich diese neue Umgebung kennen. Ich reise an einem Sonntag an, einem Ruhetag, an dem auf dem Hof nicht gearbeitet wird. Zu tun gibt es trotzdem genug und ich verbringe den Nachmittag mit der Ernte von Johannis- und Stachelbeeren.
Ich teile mir den Wohnwagen mit Hans-Jörg, einem grünen Zeitgenossen mit länglichem, sechsbebeintem Körper, den ich für eine Heuschrecke halte. Hans-Jörg ist wortkarg und zwielichtig. Ohne Vorwarnung vollführt er große Sprünge quer durch den Raum. Er läuft manchmal kopfüber an der Decke und bleibt genau über dem Bett stehen, und er hat eine Vorliebe, sich in den Vorhängen zu verstecken und lautstark zu grillen. Erst als ich Hans-Jörg Hans-Jörg zu nennen beginne, kann ich mich an seine außerirdische Erscheinung gewöhnen, und ihn als einen ruhigen und friedfertigen Mitbewohner schätzen lernen. Freunde werden wir aber trotzdem nicht, was mir zeigt, dass harmonisches Zusammenleben und Freundschaft manchmal nicht zusammenpassen. 
Fleisch
Auf dem Schafhof schließt sich ein Zerlegeraum an den Kuhstall an. Diese etwas makabre Besonderheit hat den Vorteil, dass die Kühe zum Schlachten keine weite Strecken transportiert werden müssen. Tatsächlich müssen die Kühe nicht einmal den Stall verlassen. Sie werden per Bolzenschuss vor der Tür des Zerlegeraums betäubt, dann kopfüber aufgehängt und mit einem Kehlschnitt geschlachtet. Würden Kühe soetwas wie Pantoffeln und Pyjamas tragen, dann müssten sie diese nicht einmal ausziehen, um ins Jenseits zu kommen.
Der Zerlegeraum ist ein steriler Ort mit gekachelten Wänden, einem Abfluss im Boden, Fenstern, die wie in Umkleidekabinen über Kopfhöhe angebracht sind und sich nur kippen lassen. An der Decke ist ein raffiniertes Schienensystem installiert, an dem zuerst die betäubte Kuh, dann ihr Kadaver und später das Fleisch hängen. In einer Ecke befinden sich ein Schlauch und ein Bodenabzieher zum Reinigen des Raums. Gegenüber hängen Sägen und Messer an einer Magnetschiene. Ein Gummivorhang teilt den Raum in zwei Bereiche. Hier also vollzieht sich die Transformation eines Lebewesens in ein Lebensmittel.
In mir löst der Raum Vorstellungen von blutbespritzten Wänden aus und von klebrigen Messergriffen, von zusammenbrechenden Kühen, deren Hirn von einem Bolzen durchstoßen wurde. Doch gleichzeitig gestehe ich mir ein, dass eine Kuh bei einer Hofschlachtung, wie sie auf dem Schafhof durchgeführt wird, wahrscheinlich nur wenig leidet. Bevor die Kuh verstehen kann, wie ihr geschieht, hängt sie bewusstlos und kopfüber am eleganten Schienensystem des Zerlegeraums. Die anderen Kühe merken nicht, dass ihre Artgenossin ihren irdischen Körper gerade verlässt und schauen wahrscheinlich nicht einmal von ihren Latrinen auf. Die Kuh leidet zwei Tausendstelsekunden, in denen sich der Bolzen seinen Weg bahnt. Zwei Tausendstelsekunden, die einem erfüllte Kuhleben gegeüberstehen, das auf malerischen Schwarzwaldwiesen mit dem Kauen frischer Kräuter und dem Trinken kühlen Quellwassers aus der mit Algen bewachsenen Badewanne verbracht wurde. Die Kühe auf dem Schafhof bewegen sich den ganzen Sommer frei auf ihren Weiden. Ab und zu werden sie von einer Weide auf die nächste getrieben, damit sie stets frisches Gras zum Kauen haben. Anders als bei Milchkühen, bleiben die Kälber bei den Müttern. Die Herden sind eher klein und die Tiere sehen gesund und neugierig aus. Wenn Zuchtrinder überhaupt glücklich sein können, dann sind die Kühe des Schafhofs glücklich.
Mein flüchtiges Gefühl des Grauens basiert auf Bildern, die die Kühe selbst nie sehen werden. Für die Kuh endet die Wahrnehmung noch vor Betreten des Zerlegeraums. Sie siehtn den Bodenabzieher niemals ihr schaumiges Blut zum Abfluss schieben. Sie sieht die selben vertrauten Gesichter wie immer, sie spürt vielleicht noch einen dumpfen Schlag am Kopf und schwebt dann bereits davon.
Doch warum graut es mir beim Anblick des Zerlegeraums? Ist es der Gedanke ans Töten eines Tieres, oder schon an den bloßen Tod? Letzterer ist ein unumgänglicher und natürlicher Abschluss des Lebens, der als Ende des Alten und Beginn des Neuens das Rad des Lebens antreibt. Dem Tod als solchem kann ich nichts grauenhaftes anlasten. Es sind nicht die Toten, die leiden, sondern immer die Lebendigen. Eine tote Kuh leidet nicht, ihr muss kein Mitleid entgegengebracht werden. Doch was ist mit der sterbenden Kuh, im Augenblick in der ihr Leben vorzeitig beendet wird? Verdient diese Kuh Mitleid von der Hand, die doch bis zum Ende ihres Lebens stets für ihre Gesundheit sorgte?
Der Tod der Kuh ist eine Umkehrung im Verhältnis des Gebens und Nehmens. Im Leben ist es die Kuh, die von der Bäuerin nimmt und die Bäuerin, die der Kuh gibt. Mit dem Tod der Kuh, gibt diese der Bäuerin ihr Fleisch und ernährt sie so.
Stirbt die Bäuerin eines Tages selbst, so wird sie ebensovielen Kühen das Leben genommen, wie ihnen gegeben haben.
Sowieso hört das Leben nicht mit dem Tod eines Individuums auf. Das Leben ist ein unteilbares Ganzes. Was also tut eine Bäuerin oder ein Bauer beim Schlachten einer Kuh? Ein Individuum wird ausgelöscht, aber das Leben auf dem Hof wird dadurch nicht beendet. Viel eher wird das Leben gefördert, denn die Energie, die nur dem Einen diente verteilt sich und wird nutzbar für das Viele. Es ist gerade das Verteilen, das Fließenlassen und Weiterreichen, das letztlich lebendige Prozesse ausmacht. Daraus schließe ich, dass das Töten der Kuh also das Leben als Ganzes fördert und nicht grauenhaft ist.
Wenn also weder der Tod, noch das Töten grauenhaft sind, was also erzeugt in mir diese unappetitlichen Bilder, diese Vorahnung eines Grauens?
Ich glaube, es ist die Sterilität des Zerlegeraums, der so gänzlich unbeseelt ist. Die Vorstellung dass in diesem Rahmen der Leblosigkeit und der Kälte so viele Seelen aus ihren Körpern gerissen werden, ist grauenhaft. Der Bodenabwischer, der mit dem Blut des getöteten Tiers seine letzten Spuren, seine Geschichte wegwischt, ist grauenhaft. Das Schienensystem, das aus der Schwere eines geopferten Lebens die Leichtläufigkeit eines Kugellagers macht, ist grausam. Und die Messer, die nur Kehlen, und nie Zwiebeln durchschnitten haben, die nie eine Kartoffel schälten, nie in einem Picknickkorb lagen, die nie einen Kuchen geschnitten oder ein Holz geschnitzt haben, sind Messer, die nie gelebt, sondern nur getötet haben. Solche Messer sind grausam. Das Fachgerechte, das Sachliche, das Sterile, das Optimierte und Durchdachte ist grausam. Der Grund für meine Sichtweise ist spiritueller Natur, denn nur das Geistliche, kann unterscheiden zwischen einem toten und einem lebendigen Messer. Die Ratio des Denkens sieht nur die Zusammensetzng des Stahls, die Beschaffenheit des Griffs und die Schärfe der Klinge und fragt nicht nach der Geschichte des Gegenstands, nach den Händen die es führten und die Erinnerungen in denen es verwoben wurde.
Für die Erzeugung von Lebensmitteln gibt es Regeln und Regeln sind Werkzeuge der Logik. Sie liegen dem Geistlichen fern. Um den Regeln der Lebensmittelsicherheit Folge leisten zu können, müssen Schlacht- und Zerlegeräume zwangsläufig nach rationalen Kriterien eingerichtet sein.
Mein Herz windet sich gegen die Ratio, das Kalkül und die Kühle der Logik des kommerzialisierten Schlachtens. Selbst auf diesem mustergültigen Hof, dem Schafhof, überwiegt im Moment des Tötens die regeltreue Logik und lässt kaum Raum für die spirituelle Ebene des Opfers eines Lebens für das andere.
Diese Beobachtungen führen mich zum Fazit, dass ich weiterhin Abstand vom Konsum von Fleisch nehmen möchte, selbst wenn das Fleisch aus vorbildlicher Kuhhaltung und Schlachtung wie vom Schafhof kommt. Ich befinde weiterhin, dass ich offenbar an den geltenden Vorbildern zweifle, ohne dass mir Alternativen einfallen. Ob mir wohl meine persönlichen Vorbilder zum Schlachten von Tieren noch im Laufe meiner Reise begegnen werden?
Hühner
In einem kurzen Gespräch mit M, habe ich folgendes über alternative Hühnerrassen und Hühnerzucht gelernt.
Die Hühner auf dem Schafhof gehören zu den Rassen Coffee und Cream, die von der (gemeinnützigen) Ökologischen Tierzucht gGmbH gezüchtet werden, um eine kommerzielle Nutzung bei ökologischer Hühnerhaltung zu ermöglichen. Die Hühner dieser Rassen legen weniger Eier als Hybridhennen von Lohmann Breeders, einem Monopolisten der industrialisierten Hühnerzucht. Diese sogenannten Lohmann-Hennen legen unnatürlich viele Eier, sodass sie zur Unterernährung neigen. Sie benötigen spezielles Kraftfutter, um die hohe Produktionsrate aufrechtzuerhalten. Eine ökologische Fütterung im Sinne der Kreislaufwirtschaft ist mit solchen Hühnern kaum möglich. Überhaupt haben Lohmann-Hühner wenig mit Natur zu tun. Sie haben verkümmerte Instinkte und können nicht einmal selbst ihre Eier ausbrüten.
Das folgende Video zeigt, wie Hühner für die Eierproduktion industrialisiert werden. In dem Video wird eine hybride Legehennenrasse beworben. Das Video erinnert an eine Werbung für eine industrielle Maschine und hebt in keiner Weise hervor, dass das beworbene "Produkt" ein Lebewesen mit Gefühlen und einer Seele ist.
Ältere Hühnerrassen sind viel selbstständiger als Hybridhennen, robuster, benötigen kein spezielles Futter und sind weniger anfällig für Krankheiten, aber sie legen oft nicht einmal halb so viele Eier. Eine kommerzielle Haltung mit alten Rassen ist quasi nicht möglich, denn selbst wenn 60 oder 70 ct pro Ei verlangt werden (vgl. zuletzt 30ct pro Bio-Ei bei Lidl), können die Kosten kaum gedeckt werden. So viel habe ich auf dem Schafhof gelernt.
Die Hühnerrassen Coffee und Cream sollen ein bisschen die Welt des Geldverdienens mit der Welt des Umweltschutzes vereinen. Sie stammen von robusten alten Sorten ab, legen aber mehr Eier als diese. Außerdem besitzen sie Eigenschaften, die sie für die Fleischproduktion qualifizieren, was bedeutet, dass sie doppelt verwertet werden können. Das erhöht die Konkurrenzfähigkeit gegen Lohmann-Hennen. Ein entscheidender Vorteil von Hühnerrassen aus gemeinnütziger Hand, wie die der Ökologischen Tierzucht gGmbH, ist dass das geistige Eigentum am Erbgut der Tiere dann zumindest in der Hand einer gemeinnützigen Körperschaft ist und nicht in der eines Konzerns mit Monopolstellung wie Lohmann Breeders.
Der Schafhof
Auf dem Schafhof habe ich viel über die Haltung von Kühen, Hühnern und Pferden gelernt. Ich habe meine Einblicke in das Leben in einer Kommune vertieft und ein paar Tricks abschauen können (zum Beispiel die morgendliche Arbeitsbesprechung im Stehen durchzuführen, um nicht zu versacken). Ich habe auch gelernt, dass eine Fläche von 90 ha viele Freiheiten, aber auch viele Verpflichtungen schafft. Alleine die Pflege der Elektrozäune verlangt einen wöchentlichen Einsatz des Freischneiders und um mit dem Holz aus dem eigenen Wald zu heizen, muss den ganzen Sommer über Holz gespalten werden.